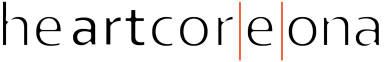Malou
Auszubildende zur Gesundheits- und Krankenpflegerin 3. Lehrjahr
Zu Beginn ihrer Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin vor knapp drei Jahren hatte die 25-jährige Marie-Louise den Wunsch, sich während ihrer Schichten auch immer mal etwas Zeit nehmen zu können, um mit den Patient*innen zu sprechen und sich ihre Ängste und Sorgen anzuhören. Es sollte für sie über die eigentliche Pflege hinausgehen, sie wollte auch mental unterstützen. Heute im dritten Lehrjahr und Monaten auf der Corona-Station ist Malou, wie sie genannt wird, komplett desillusioniert: „Obwohl ich nicht einmal mit der Ausbildung fertig bin, ist mir dieser Gedanke ‚etwas anderes zu machen‘ in letzter Zeit häufiger gekommen. Ich möchte nicht weiter verheizt werden und unter Bedingungen arbeiten, die auf Dauer nicht machbar sind.“

Die junge Frau mit den dunklen langen Haaren ist frustriert: „Der Beruf kann an sich unglaublich schön, abwechslungsreich und interessant sein, doch mittlerweile scheinen die negativen Aspekte zu überwiegen und ich kann jeden verstehen, der dem Job den Rücken zukehrt. Ich hoffe, dass die Politik irgendwann wirklich erkennt, was Pflegende leisten und dass eine kleine Lohnerhöhung und etwas Anerkennung in den Medien nicht ausreichen. Es muss sich so viel ändern.“
Aus Malous Sicht hat die Politik in vieler Hinsicht versagt. Sie ist sich unsicher, wie lange die Pflegekräfte in den Krankenhäusern und Altenpflegeheimen dem Druck noch standhalten können. „Nach meinem Einsatz auf der Corona-Station habe ich stark an meinem Beruf gezweifelt und fühlte mich aber auch in gewisser Hinsicht machtlos etwas daran zu ändern.“ Damit ist sie nicht allein. Auf der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin heißt es, dass 32 Prozent der Pflegekräfte überlegen, nach Ende der Corona-Krise aus dem Beruf auszusteigen.
Bereits im ersten Lockdown hat die 25-jährige gelegentlich mit Corona-Patienten zu tun, muss selbst ein-zweimal in Quarantäne und hat einige PCR-Tests über sich ergehen lassen müssen. Doch im Dezember 2020 wird sie ins kalte Wasser geworfen: Ab dem 24. Dezember ist sie auf der Corona-Normalstation, dem Bereich, in dem die nicht intensiv-pflichtigen Patient*innen betreut werden, im Einsatz. „Ich wusste bereits, dass die Situation auf der Station nicht allzu gut war, doch habe ich mir keine großen Gedanken darüber gemacht, wie es tatsächlich läuft. Schließlich arbeiteten wir auch bereits vor Corona unter Druck und mangelndem Personal.“, so Malou. Sie freut sich zunächst darauf das Weihnachtsfest mit ihren Patient*innen zu verbringen und ihnen das Gefühl von Geborgenheit und festlicher Stimmungen vermitteln zu können. Doch ab der ersten Minute im Dienst tritt die große Ernüchterung ein. „Sofort wurde ich in die Tätigkeiten eingespannt – an sich nichts Neues – doch der Zeitdruck und die Aufgaben für zwei Pflegende und eine Auszubildende für etwa 20 Patienten (die meisten davon in Vollpflege) waren nicht machbar.“
mit Corona-Patienten zu tun, muss selbst ein-zweimal in Quarantäne und hat einige PCR-Tests über sich ergehen lassen müssen. Doch im Dezember 2020 wird sie ins kalte Wasser geworfen: Ab dem 24. Dezember ist sie auf der Corona-Normalstation, dem Bereich, in dem die nicht intensiv-pflichtigen Patient*innen betreut werden, im Einsatz. „Ich wusste bereits, dass die Situation auf der Station nicht allzu gut war, doch habe ich mir keine großen Gedanken darüber gemacht, wie es tatsächlich läuft. Schließlich arbeiteten wir auch bereits vor Corona unter Druck und mangelndem Personal.“, so Malou. Sie freut sich zunächst darauf das Weihnachtsfest mit ihren Patient*innen zu verbringen und ihnen das Gefühl von Geborgenheit und festlicher Stimmungen vermitteln zu können. Doch ab der ersten Minute im Dienst tritt die große Ernüchterung ein. „Sofort wurde ich in die Tätigkeiten eingespannt – an sich nichts Neues – doch der Zeitdruck und die Aufgaben für zwei Pflegende und eine Auszubildende für etwa 20 Patienten (die meisten davon in Vollpflege) waren nicht machbar.“
Keine Sekunde bleibt Malou, um ihren Patient*innen und Kolleg*innen ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen. Die Zeit ist zu knapp und scheint zu rennen, sie hat Angst, ihre Aufgaben nicht erfüllen zu können. Neben dem Verteilen und Verabreichen von Medikamenten, müssen die 25-jährige und ihre Kolleg*innen viele labordiagnostischen Untersuchungen machen und diese auch gleich auswerten, um sie den Ärzt*innen überreichen zu können.
Die zahlreichen Patient*innen müssen ihren Sauerstoff erhalten, mehrmals am Tag inhalieren und es erfolgen die regelmäßigen Blutdruck- sowie Puls- und Temperaturkontrollen. Die Diabetiker dürfen ihr Insulin nicht vergessen und weitere Begleiterkrankungen müssen gepflegt und versorgt werden. Doch damit nicht genug. Das Pflegepersonal muss neben all diesen Tätigkeiten auch noch eine Vielzahl an Dokumentation pflegen. „An sich wäre dies machbar mit mehr Personal, doch aufgrund des Mangels an Pflegekräften, der hinderlichen Schutzkleidung, die man die ganze Schicht hindurch tragen muss, war es eine Herausforderung. Viele Dinge konnten wir nicht angemessen durchführen und ich bedaure sagen zu müssen, dass auch der Mensch hinter dem Patienten vergessen worden ist.“
 Am Ende ihrer ersten Schicht auf der Corona-Station ist Malou den Tränen nahe, fühlt sich ausgelaugt, niedergeschlagen und zweifelt an ihren beruflichen Fähigkeiten. „Es war schon beinahe beruhigend zu sehen, dass auch gestandene Schwestern die 20, 30 Jahre in dem Beruf arbeiteten mit den Nerven am Ende waren.“ Ein solches Weihnachten hat die angehende Gesundheits- und Krankenpflegerin zuvor noch nie erlebt. Endlich zuhause ist sie sich unsicher, ob sie die bevorstehenden Wochen auf der Station überstehen wird.
Am Ende ihrer ersten Schicht auf der Corona-Station ist Malou den Tränen nahe, fühlt sich ausgelaugt, niedergeschlagen und zweifelt an ihren beruflichen Fähigkeiten. „Es war schon beinahe beruhigend zu sehen, dass auch gestandene Schwestern die 20, 30 Jahre in dem Beruf arbeiteten mit den Nerven am Ende waren.“ Ein solches Weihnachten hat die angehende Gesundheits- und Krankenpflegerin zuvor noch nie erlebt. Endlich zuhause ist sie sich unsicher, ob sie die bevorstehenden Wochen auf der Station überstehen wird.
Der Grund ist nicht nur, dass das Ansteckungsrisiko trotz Schutzkleidung mehr als doppelt so hoch ist wie in anderen Einsatzgebieten, vielmehr weiß sie nicht, ob sie dem emotionalen Druck auf Dauer standhalten kann und will. „Dass Menschen sterben, ist etwas, an das man sich während der Ausbildung gewöhnt! Doch es gibt meist die Möglichkeit die Menschen in Würde und Ruhe gehen zu lassen, auf der Corona-Station fehlen mir diese Aspekte und scheinen nur mehr Arbeit zu machen.“ Um sich selbst zu schützen, versucht Malou, die Schicksale der Patient*innen nicht mehr allzu nah an sich heranzulassen.
Ablenkung und Abwechslung gibt es für sie seit Beginn der Corona-Krise nur selten. „Viele haben ihren Job verloren, sind in Kurzarbeit oder ins Homeoffice. Ich hingegen scheine nur noch auf Arbeit zu sein und auch nach dem Dienst nicht mehr davon loszukommen. Auch wenn Überstunden für mich als Auszubildende die Seltenheit bleiben, verbrauche ich meine ganze Energie in diesen 8,5 Stunden.“ Doch das macht sich zum Glück auch finanziell bei der Auszubildenden bemerkbar: „Ich kann von Glück sagen, dass es mir finanziell noch nie so gut ging wie heute. Ich erhalte mein Ausbildungsgehalt, was zwar nicht die Welt ist, aber von dem es sich gut leben lässt. Da ich in der Pflege tätig bin, habe ich während Corona auch einen kleinen Bonus bekommen. Dem stehe ich jedoch recht kritisch gegen. Was einst als Geste der Anerkennung gedacht war, empfinde ich mittlerweile nur als Trostpflaster für die schlechten Arbeitsbedingungen, die sich in naher Zukunft nicht bessern werden.“